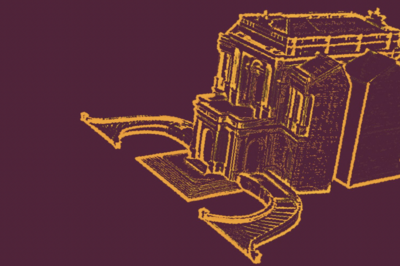Welcome at the Interface Culture program website.
Acting as creative artists and researchers, students learn how to advance the state of the art of current interface technologies and applications. Through interdisciplinary research and team work, they also develop new aspects of interface design including its cultural and social applications. The themes elaborated under the Master's programme in relation to interactive technologies include Interactive Environments, Interactive Art, Ubiquitous Computing, game design, VR and MR environments, Sound Art, Media Art, Web-Art, Software Art, HCI research and interaction design.

The Interface Culture program at the Linz University of Arts Department of Media was founded in 2004 by Christa Sommerer and Laurent Mignonneau. The program teaches students of human-machine interaction to develop innovative interfaces that harness new interface technologies at the confluence of art, research, application and design, and to investigate the cultural and social possibilities of implementing them.
The term "interface" is omnipresent nowadays. Basically, it describes an intersection or linkage between different computer systems that makes use of hardware components and software programs to enable the exchange and transmission of digital information via communications protocols.
However, an interface also describes the hook-up between human and machine, whereby the human qua user undertakes interaction as a means of operating and influencing the software and hardware components of a digital system. An interface thus enables human beings to communicate with digital technologies as well as to generate, receive and exchange data. Examples of interfaces in very widespread use are the mouse-keyboard interface and graphical user interfaces (i.e. desktop metaphors). In recent years, though, we have witnessed rapid developments in the direction of more intuitive and more seamless interface designs; the fields of research that have emerged include ubiquitous computing, intelligent environments, tangible user interfaces, auditory interfaces, VR-based and MR-based interaction, multi-modal interaction (camera-based interaction, voice-driven interaction, gesture-based interaction), robotic interfaces, natural interfaces and artistic and metaphoric interfaces.
Artists in the field of interactive art have been conducting research on human-machine interaction for a number of years now. By means of artistic, intuitive, conceptual, social and critical forms of interaction design, they have shown how digital processes can become essential elements of the artistic process.
Ars Electronica and in particular the Prix Ars Electronica's Interactive Art category launched in 1991 has had a powerful impact on this dialog and played an active role in promoting ongoing development in this field of research.
The Interface Cultures program is based upon this know-how. It is an artistic-scientific course of study to give budding media artists and media theoreticians solid training in creative and innovative interface design. Artistic design in these areas includes interactive art, netart, software art, robotic art, soundart, noiseart, games & storytelling and mobile art, as well as new hybrid fields like genetic art, bioart, spaceart and nanoart.
It is precisely this combination of technical know-how, interdisciplinary research and a creative artistic-scientific approach to a task that makes it possible to develop new, creative interfaces that engender progressive and innovative artistic-creative applications for media art, media design, media research and communication.
Denkmal 1945/2025: Künstlerische Entwürfe für die Zweite Republik
Eröffnung: 22. April 2025, 18.30 Uhr Ausstellung bis 23. November 2025 Haus der Geschichte Österreich, Neue Hofburg, Heldenplatz, Wien
Eine Ausstellung am Haus der Geschichte Österreich in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz
Im Frühjahr 2025 jähren sich die Ausrufung der Zweiten Republik und die Befreiung Österreichs von der NS-Herrschaft zum 80. Mal. Welche Gestalt könnte ein Denkmal annehmen, das sich die Republik Österreich selbst anlässlich dieser beiden historischen Momente und ihrer Bedeutung für die Gegenwart schenkt?
In Kooperation mit der Kunstuniversität Linz hat das Haus der Geschichte Österreich anlässlich von 80 Jahren Zweiter Republik die Künstler*innen Ramesch Daha / Fabian Antosch / Philipp Oberthaler, Gabriele Edlbauer und Franz Wassermann eingeladen, im Museumsfoyer drei Modelle für fiktionale Denkmäler für den Altan der Neuen Hofburg zu präsentieren, wo Adolf Hitler am 15. März 1938 den „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland bekannt gegeben hat.
Seit 2018 setzt sich das Haus der Geschichte Österreich mit der Geschichte und Gegenwart des Altans vielfältig auseinander. Die Präsentation der künstlerischen Modelle für ein Denkmal am Altan knüpft hier an. Sie dient als Anregung für Diskussionen über staatliche Geschichtssymbolik 80 Jahre nach der Befreiung von der NS-Herrschaft und über den künftigen Umgang mit dieser erinnerungspolitischen Leerstelle mitten am Heldenplatz.
Eröffnung
Begrüßung und Einführung
Monika Sommer, Gründungsdirektorin hdgö
Brigitte Hütter, Rektorin Kunstuniversität Linz
Karin Harasser, Professorin für Kulturwissenschaft an der Kunstuniversität Linz im Gespräch mit den Künstler*innen:
Ramesch Daha / Fabian Antosch / Philipp Oberthaler
Gabriele Edlbauer
Franz Wassermann
Eröffnung der Ausstellung
Andreas Babler, Vizekanzler
Die Entwürfe
Entwurf von Ramesch Daha / Fabian Antosch / Philip Oberthaler
Altan, verdacht, 2024/2025, Vollholz gefräst, Plexiglas, Spiegelglas
Wie würde diese Idee den Umgang mit der österreichischen Vergangenheit verändern?
Hat sich die Republik Österreich nur ein wenig verdacht, als sie sich bis zur „Waldheim-Affäre“ als Opfer des Nationalsozialismus gesehen hat? Der Entwurf “Altan, verdacht“ bezweifelt die Unschuld des Gedankens und Gedenkens. Er deckelt die Terrasse mit einer Glasplatte, unter der ein*e Erwachsene*r gerade einmal aufrecht stehen könnte. Eine Nutzung als Ort der Selbstüberhöhung, etwa“als Bühne einer Ansprache, ist nicht länger möglich. Die 80 cm dickegläserne Decke markiert historische Brüche – zwischen Erster und Zweiter Republik, zwischen Diktatur und Demokratie –, verweigert aber eine eindeutige Botschaft. Diese ins Material getriebene erinnerungspolitische Leerstelle ist nicht vereinnahmbar. Im Gegenteil lastet sie, vom Heldenplatz aus betrachtet, auf den Besucher*innen, die, wie Karyatiden, die Verdachung zu tragen scheinen.
Entwurf von Franz Wassermann
MAHNWACHE, 2024/2025, 3D-Druck aus PAL, Granitstein aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen
Wie würde diese Idee den Umgang mit der österreichischen Vergangenheit verändern?
Wer oder was wird das Gedenken einmahnen, wenn die Zeitzeug*innen nicht mehr sprechen können? Diese Aufgabe wird in Franz Wassermanns Entwurf für den Altan einem massiven, unbearbeiteten Granitblock aus dem Steinbruch des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen übertragen. Die rohe Steinmasse verkörpert die Politik des Todes des Nationalsozialismus: die Ermordeten und Geschundenen des Lagersystems. Der im Modell verbaute Stein kommt aus Mauthausen und ist damit ein materieller Zeuge. Der schweigsame Wächter belastet fortan einen Ort, der der Propaganda diente, denn er steht an jenem Platz, von dem aus Adolf Hitler die berüchtigte „Anschlussrede“ hielt. Vom Balkon aus blickt er auf den Heldenplatz und damit auf die Erinnerung an eine frenetisch jubelnde Menge. Er schaut aber auch zum Parlament, zum Ort gelebter Demokratie und buchstäblich eingeschriebener Menschenrechte.
Entwurf von Gabriele Edlbauer
Good Riddance, 2025, Steinzeug glasiert, Zinn, Glas, Zimmerbrunnenpumpe, Schläuche
Wie würde diese Idee den Umgang mit der österreichischen Vergangenheit verändern?
Was wäre, wenn der Altan ins Innere der Hofburg geklappt würde,nach innen gekehrt, und damit zur Ausstellungsfläche des hdgö? Der vom Nationalsozialismus kontaminierte Ort würde musealisiert und gleichzeitig ein anderer Raum hergestellt werden. In einer spekulativen Geste schafft der Entwurf Good Riddance Platz für ein anderes Gedenken: Das bestehende Alma Rosé-Plateau würde durch die Verdrehung hinaus auf den Heldenplatz geschoben. Es fungierte in Zukunft als Ort des Andenkens an die im KZ Auschwitz-Birkenauumgekommene, aus Wien stammende jüdische Geigerin Alma Rosé.Eine Brunnenanlage würde an den Ort des ersten Auftritts der 15-jährigen Musikerin im Kurhaus Bad Ischl erinnern und ein Brunnen eine neue Geräuschkulisse schaffen. Der Unkontrollierbarkeit der Erinnerung begegnet die Skulptur mit einem Vorschlag des wilden, vielleicht sogar wütenden, Gedenkens.