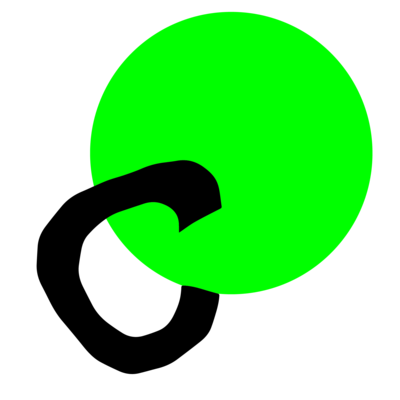Wöchentliche Lieferung: STAY IN TOUCH 9
Stay in touch ist eine Kollaboration der Kunstuniversität Linz, Abteilung Kulturwissenschaft mit dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), der Zeitschrift für Kulturwissenschaften, dem ilinx-Magazin und weiteren Partnerinstitutionen.
Es wird eine Bibliothek von Texten zusammengestellt, die dabei unterstützen, einen solidarischen und informierten Umgang mit der Pandemie zu finden. Es werden klassische und aktuelle Texte aus 2500 Jahren kommentiert und zur Verfügung gestellt.
Diese Woche:
2017 – Santé publique und Kritik
Didier Fassins »The Endurance of Critique«
wiedergelesen
Von Anna Echterhölter
Das aktuelle Kopfschütteln über die Positionen der Impfgegner*innen und der linken wie rechten Populist*innen der Querfront mischt sich oftmals noch ein viel grundsätzlicherer Unglauben. Dieser entsteht angesichts der neueren und neuesten Positionen der vermeintlich emanzipativen, theoretischen Kritik. Immer unklarer wird, was Kritik ausmacht, wo Kritik überhaupt einhaken kann und was sie als Prinzipien verteidigen muss, um noch sie selbst zu sein. Beim Lesen von Didier Fassins The Endurance of Critique (2017) legt sich das resultierende Schwindelgefühl nicht sofort, aber der Text bietet Stoff für Überlegungen.
»Endurance« assoziiert Fassin mit dem Erdulden einer Strapaze. Die Kritik hat derzeit einen schweren Stand. Im Strudel von Häme und Häresie, Verschwörungstheorie und fake news, posttruth und Kritikverboten in Schonräumen ist das Konzept selbst schweren Angriffen ausgesetzt. Für Fassin sind die Exzesse und aggressiven Stilblüten der Kritik allerdings kein Grund, kopfschüttelnd abzuwarten. Charakteristisch für seine Kritikauffassung ist, dass er die Turbulenzen, in die das kritische Denken geraten ist, für Symptome einer reaktionären Wende der Gesellschaft hält. Die Folgerung: »Let us then use the discomfort around critique as an occasion for its reassessment.«
Fassin benennt in diesem Text die Flieh- und Zugkräfte nicht genau, die seiner Meinung nach das Prinzip der Kritik in Schieflage bringen: Die üppigen Finanzströme für rechte Systemgegner, die vorurteilsverstärkenden Suchalgorithmen, die neuen Kriege im Namen des Humanismus: Man ist auf Vermutungen angewiesen. Es kann aber nicht genug hervorgehoben werden, dass Fassin Materialist bleibt. Ungleichheit und ökonomische Macht werden als Begründungsdimension der Kritikgeschichte stets eingefordert und dies im Gegensatz zu vielen Metakritiken aus dem vermeintlich linken Lager, bei denen ideengeschichtliche Schuldzuweisungen an die Postmoderne oder die Gender Studies derzeit eine unerklärliche Faszinationskraft auszuüben scheinen.
Der Aufsatz geht auf drei Fallstudien ein: AIDS-Leugnung in Südafrika, Traumata in Palästina und Polizeiarbeit in den französischen Banlieue. Fassin ist nicht konfliktscheu. Von den Beispielen ist vor allem das erste für die aktuelle Situation von Bedeutung. Seine im Artikel integrierte Theoriegeschichte ist im Feld verankert und dort fast ausnehmend in Elendsquartieren, wo rationale Lösungen oft wesentlich schwieriger mit den Lebensumständen in Einklang gebracht werden kann als in den Zentren der Aufklärung. Das Problem der Ungleichheit, das zu den Grundpfeilern der Kritik gehört, wiegt bei Fassin jederzeit schwerer als der Kosmos der Schrift. Diese Bodenhaftung mag seinen Feldforschungen als Sozialanthropologe und Nachfolger von Clifford Geertz in Princeton geschuldet sein. Man kann in seiner pragmatischen Kalibrierung theoretischer Positionen aber auch ein Echo eines früheren Lebens vermuten, in dem Fassin als aktivistischer Internist oder Vize-Präsident von Médécins sans Frontières amtierte. Zuletzt hatte er einen Lehrstuhl für das öffentliche Gesundheitswesen (Santé publique) am Collège de France inne.
Die Geschichte der Kritik ist keine Medizin- oder Seuchengeschichte, obwohl d’Alemberts statistische Berechnungen zur Impfgefahr bei Pockenerkrankungen durchaus als Gründungsdokument der Aufklärung firmieren sollten. Das Infektionsgeschehen bei Menschen tritt in Fassins Artikel über das Kränkeln der Kritik jedoch auf und es erweist sich als Nährboden für Verzerrungen der westlichen Selbstverständlichkeiten.
Sechs Jahre lang hat Fassin in Südafrika miterlebt, wie das Land zu einem Epizentrum der AIDS-Pandemie avancierte. Prognosen sahen die Lebenserwartung von Erwachsenen um 20% sinken und man registrierte jeden vierten Erwachsenen als HIV-positiv, wobei die schwarze Bevölkerung unverhältnismäßig stark betroffen war. Science denialism, die Zurückweisung wissenschaftlicher Erklärungen, begann zu grassieren und wurde selbst von Entscheidern in den höchsten politischen Ämtern formuliert. Die Verursachung der Immunschwächeerkrankung durch Erreger wurde angezweifelt, die Wirksamkeit der Medikamente abgestritten oder im Verhältnis zu ihren fatalen Nebenwirkungen als vernachlässigbar heruntergespielt. Auch in Fassins Monographie über dieses Thema (When Bodies Remember 2007) ist es schmerzhaft, über diese Reaktion auf die Krise zu lesen. Abkanzeln, den Schlussstrich ziehen, restlos verurteilen: All das will Fassin den Leser*innen jedoch nicht durchgehen lassen. Stattdessen fordert er historisch anthropologische Tiefenschärfe im Verständnis dieser folgenreichen Ansichten über das Virus. Er erwähnt das im Südafrika der Jahrtausendwende plausible Narrativ, dass es »der Westen« gewesen sei. AIDS wäre absichtlich in Südafrika eingeschleust worden, um insbesondere die schwarze Bevölkerung zu dezimieren und sie für medizinische Versuche zu missbrauchen. Wie für Verschwörungstheorien kennzeichnend, wird in einer angstbesetzten Situation einer kleinen Gruppe Mächtiger die Lenkung des Geschehens zugeschrieben. War nicht die Sterblichkeitsrate bei der schwarzen Bevölkerung besonders hoch? Damit konnte zugleich verschleiert werden, dass die katastrophalen Arbeitsbedingungen in einfachen Beschäftigungsverhältnissen die schwarze Bevölkerung wesentlich härter trafen. Verschwörung und Herrschaftsverhältnisse bedingen einander. Aber auch die postkoloniale Situation des Landes war ein gravierender, im Westen gern übersehener Motivationsfaktor der Verschwörungstheoretiker*innen. Die kollektive Erinnerung Südafrikas bestätigt das Erklärungsmuster einer missgünstigen, ausländischen Elite als faktisch. Die Pest-Epidemie von 1900 wurde von der Kolonialverwaltung genutzt, nicht um Kranke und Gesunde, sondern um Weiße und Schwarze zu trennen. Letztere wurden in Reservate gezwungen, was als Grundstein der Apartheid und Rassensegregation des späten 20. Jahrhunderts gilt.
Fassin geht an dieser Stelle noch nicht so weit, die Verschwörungstheorie selbst als eine Form von Kritik zu bezeichnen. In der Art wie er Gewaltgeschichte, Genealogie und moral anthropology zur Erklärung des Irrationalismus heranzieht, liegt jedoch auch eine beunruhigende Vertrautheit. Er pocht darauf, dass ein Ernstnehmen der Verschwörung, ein sich Einlassen auf die Verständnismuster, die die Verschwörung in Zeiten der Seuche beflügeln, ein Entschlüsseln des Irrationalismus ermöglicht und nicht den Untergang der Kritik bedeutet. Er sieht die Verantwortung für die Verschwörungstheorie zudem zum Teil bei den Verursacher*innen der Ungleichheit. Dennoch fragt man sich, ob es Positionen gibt, die dieses Entgegenkommen nicht verdienen, oder ob hinter den derzeit immer vernehmlicher werdenden Corona-Mythen der Marktplätze ebenfalls Gewalterfahrungen stehen. Die ausgerenkte, seltsame Kritik der AIDS-Leugner in Südafrika bleibt allerdings Anlass zur Kritik und wird jedoch nicht selbst in den Rang einer solchen erhoben. Die Verschwörungstheorie selbst wird im hegemonialen Gefüge als eine Kraft konturiert, die sich aus der lokalspezifischen Gewaltgeschichte heraus erklären lässt. Anstatt die Kritik mit der Rationalität des Gegenstandes zu identifizieren, fordert Fassin Analysen der Ungleichheit als zentrale Praxis des kritischen Denkens.
Dass Fassin die Explikation irrationaler Positionen als eine mögliche Aufgabe der Kritik aufruft, hat mit der Position zu tun, die er im methodischen Feld der akademisch geführten Metakritikdiskussion bezieht. Fassin setzt an Bruno Latours Nachruf auf die Kritik an (Why Has Critique Run Out of Steam? 2004). Als letzterer damals eine Umorientierung von den matters of fact zu den matters of concern forderte, verband sich dies mit einer Sorge, dass die Kritik an Kraft verloren habe. Alles und jede Kritik würde sofort von den Marktmechanismen absorbiert und unterhöhlt, womit jegliches Potential kritischer Praxis und realer Veränderung sofort verpuffen würde, wie auch Boltanski/Chiapello festgestellt hatten. Auch wenn die 1920er Jahre und die späten 1960er Jahre als Blütezeiten der Kritik vielleicht uneinholbar sind, sieht Fassin dennoch keinen Grund für diese Sorge über das gänzliche Verblassen der Kritik. Er benennt zwei Reservoirs des kritischen Diskurses und damit zwei fortdauernde Traditionen des Kritischen, die er trotz Schwächephasen nicht zynisch betrachtet wissen will: Einerseits die Kritische Theorie in der Tradition der Frankfurter Schule, der Marxisten oder Freuds, und andererseits den Komplex der genealogischen Kritik im Sinne Nietzsches und Foucaults.
Für den ersten Modus der Kritik ist prägend, dass er in erster Linie Ideologiekritik ist. Schleier müssen gelüftet werden, falsches Bewusstsein wird aufgeklärt und mit der wahren Erkenntnis lassen sich unweigerlich auch die Verhältnisse besser und rationaler einrichten. Für den zweiten Modus der genealogischen Kritik gilt, dass die Wahrheits- und Machteffekte einander bedingen und diese motivationalen Verschränkungen verstanden werden müssen, die Subjekte zu Partisanen einer spezifischen Wahrheit machen: »In the first case, the subjects are supposed to move from falsehood to truth, whereas in the second, they are expected to understand that there exist other potential arrangements between true and false.« (14)
Inspiration für die zweite Position entnimmt Fassin der history from below ebenso wie der Geschichte der Rationalität bei Ian Hacking oder Lorraine Daston (Les économies morales revisitées 2009). Ausgerechnet der fürsorgenden Rationalität stellt Fassin allerdings ein vernichtendes Zeugnis aus (La Raison humanitaire 2010). Er verfolgt dort die Rhetorik der Staaten, die mittels der Pose humanitärer Intervention nach 1989 eine neue Geopolitik salonfähig machen.
Beide Reservoirs der Kritik hält er, zur Erschütterung der Anhänger*innen wohl beider Verfahren, für kombinierbar, obwohl sich ihre Auffassungen von Wahrheit grundlegend und unvereinbar unterscheiden. Wer nun annimmt, die kritische Theorie habe Fassin für dieses Bekenntnis zu beiden Traditionen exkommuniziert, kann sich in den Adorno-Vorlesungen des Autors des Gegenteils überzeugen (Das Leben: Eine Kritische Gebrauchsanweisung 2016).
Die Theoriegeschichte der Kritik hat sich zu einem umfänglichen Genre ausgewachsen (Allerkamp/Witt Gegen/Stand der Kritik 2005, Saar Genealogie als Kritik 2007, Forst Sozialphilosophie und Kritik 2009, Jaeggi/Wesche Was ist Kritik? 2019). Auch Fassins Aufsatz wird direkt weiter diskutiert (A Time for Critique 2019).
Die Tatsache, dass die Kritik – und mit ihr die öffentliche Gesundheit – inmitten der Vielheit sich bedingender Katastrophen derzeit angeschlagen ist, nimmt Fassin zum Anlass für einen intellektuellen Auftrag. Er möchte die Wissenschaft nicht dorthin aussenden, wo gesellschaftliche Emanzipation geschieht, sondern seine Gesellschaftsanalyse im Gegenteil ansetzen lassen: Im Schlingern, Versagen und Verdrehen der Kritik. Die Empfehlung lautet: »Making sense of what seems peculiar« (10). An Anlässen für ein solches Verfahren ist derzeit kein Mangel.
Didier Fassin: The endurance of critique. In: Anthropological Theory 17, 1, 2017, 4–29. Download von der Seite des Autors